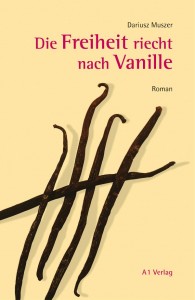 Es ist nicht ungewöhnlich, daß ein ausländischer Schriftsteller in Deutschland Romane schreibt, doch bleibt es eine einzigartige Ausnahme, wenn ein Pole sich der „Sprache des Feindes“, der deutschen Sprache bedient. Die Reaktionen sind teilweise drastisch, denn sie haben etwas mit der Wahrheit und deren Wahrnehmung zu tun, die bei manchen Zeitgenossen sich unversöhnlich gegenüber stehen – in Polen wie in Deutschland.
Es ist nicht ungewöhnlich, daß ein ausländischer Schriftsteller in Deutschland Romane schreibt, doch bleibt es eine einzigartige Ausnahme, wenn ein Pole sich der „Sprache des Feindes“, der deutschen Sprache bedient. Die Reaktionen sind teilweise drastisch, denn sie haben etwas mit der Wahrheit und deren Wahrnehmung zu tun, die bei manchen Zeitgenossen sich unversöhnlich gegenüber stehen – in Polen wie in Deutschland.
Der Schriftsteller Dariusz Muszer hat diesen Schritt gemacht und einen großen Erfolg bei der diesjährigen Buchmesse in Frankfurt erfahren, u.a. hat sich der bekannte polnische Romancier Pawel Huelle enthusiastisch zum Autoren und dessen Werk. „Die Freiheit riecht nach Vanille“ ist ein Geschichtsbuch, mit Momentaufnahmen eines Emigrantenschicksals vereint, aber auch ein Krimi, in dem das Motiv „born to kill“ vorgestellt wird, das Töten ohne Motiv, übrigens Alltagserfahrung der polnischen Nation unter deutscher Besatzung im letzten Krieg.
Muszer ist nicht nur sprachgewaltig und entwickelt gekonnt angloamerikanische Erzählweisen weiter, er hat auch etwas erlebt. Im Gegensatz zu seinen Jahrgängen in Deutschland hat die hiesige Generation nicht mehr wie deren Eltern gebrochene Biografien. Muszer schon, denn der 1959 in Westpolen geborene Autor hat sein Land verlassen und 1988 einen völligen Neuanfang gewagt. Ungewöhnlich auch sein beruflicher Lebenslauf: nach seinem Jurastudium in Posen arbeitete er als Staatsanwalt, Schauspieler, Theaterleiter, Dachdecker, Musiker, Taxifahrer, Journalist und Totengräber. Deutsche Journalisten fragen verwundert nach, ob dieser bunte Strauß von Beschäftigung eine Idee der PR-Abteilung seines Verlages sei und müssen dann staunend zur Kenntnis nehmen: dieser Autor hat tatsächlich in den angegebenen Berufen gearbeitet.
Muszer lebt heute in Hannover, einer Stadt ohne Gesicht und Eigenschaften, wie er schreibt. Den Kampf mit der Lüge, Kleinkariertheit, Ignoranz und Vergangenheit in Polen hat er bewältigt, läßt seine Erfahrungen der Wanderung von Ost nach West in den Roman einfließen, die auch europäische sind. Damals, als junger Mann in Polen lernte er von einer Jüdin Deutsch. Das war verboten. Muszer hat diese Sprache lieben gelernt, schätzt deren Präzision, arbeitet an ihr, ohne sie stereotyp zu instrumentalisieren. Polnisch bleibt für ihn gleichwohl die schönste Sprache, kann sie doch außergewöhnlich beeindruckend blumig und romantisch sein. Er weiß, daß in Deutschland mehr der Inhalt, in Polen mehr die Form zählt.
Die Reaktionen einiger seiner ehemaligen Landsleute fallen z.T. jedoch harsch aus: ein „Volksverräter“, der sich dieser „Schandsprache“ bediene, nach allem, was die Deutschen den Polen angetan hätten. Muszer selbst nimmt an, daß es nur noch einige hundert Jahre dauern werde, bis die deutsche Sprache in Europa verschwinden werde, daß ein ähnlicher Prozeß laufe wie in den USA, wo z.B. die offizielle englische Sprache durch die spanische allmählich verdrängt werde. Sieht seine Arbeit auch als konservierendes Element von etwas, das ihm wichtig scheint.
Die Frage nach der Identität, ob er nun Pole oder Deutscher sei, stellt sich für ihn nicht so. Selbst der Begriff des Europäers ist für ihn zu kurz gefaßt. Muszer vertritt eine planetarische Position: die Menschen seien aus einem großen schwarzen Loch gekommen und werden dorthin wieder verschwinden. Und überhaupt: er habe bisher in Deutschland nur Mischlinge getroffen, was bedeute es, wenn man sich da als Deutscher oder Pole, als Europäer im traditionellen Sinne bezeichne? Der Gastaufenthalt auf der Erde sei ein Zwischenspiel, wo die Frage der nationalen Zugehörigkeit in den Hintergrund trete. So verkehrt er nebenbei den gängigen Zeitvektor Zukunft in die Zukunft der Vergangenheit um. Und das scheint logisch: ein Emigrant denkt öfter an die Vergangenheit als ein Eingeborener, sind die unterschiedlichen Lebenssituationen krass getrennt, jedenfalls gilt das für den Helden des Buches Naletnik.
In diesem Sinne ist auch sein erster veröffentlichter Roman in Deutschland zu sehen. Aus den Wirrnissen der Kriegszeit ist ein Lebenslauf entstanden, der mit einem Kopfschuß begann und einer Ejakulation endete. Die ukrainische, polnisch, jüdisch, sorbisch, deutsche Netzwerk der Gene und Beziehungen. Die Sprache ist hart, manchmal drastisch, allerdings nicht als aufgesetztes Stilmittel, sondern den unerbittlichen Lebenslagen im Osten adäquat. Der Held Naletnik kommt als Emigrant nach Deutschland, doch es ist keine lamoryante Bilanz gescheiterter Chancen in einer Gesellschaft, in der nur das Geld zählt oder ein euphemistischer Aufstieg eines Habenichts. Die Bestandsaufnahme des polnischen Emigranten ist nämlich frei vom gesellschaftlichen Druck des Erfolges und des gängigen Wunsches, den ehemaligen Nachbarn in der verlassenen Heimat eines Tages mit dem im Westen erreichten Erfolg zu beeindrucken. Er riecht zwar den Duft der Freiheit, hält aber gleichwohl kritische Distanz zu ihr, spürt im verlockenden Angebot die Fesseln auf.
Naletnik zeigt zwar einige autobiografische Züge, bleibt aber trotzdem eine Kunstfigur, die Erfahrungen in Deutschland macht. Zum Beispiel im Auffangslager Friedland. Eine Fabrik der Deutschmacher, modifiziert, versteht sich. Für Deutsche ist dieser Ort in Niedersachsen für Ost-Emigranten unverdächtig, gilt als Hort der Hoffnung und der Beginn der Freiheit, die Muszer und Naletnik bereits auf dem hannoverschen Hauptbahnhof, genauer in der darunter liegenden Pasarelle, in Form von Vanilleduft entgegengeschlagen ist. Für die Sicherheitsbehörden ist es ein idealer Platz, Informationen zu erhalten. Doch mit den polnischen Erfahrungen geht man einem deutschen Lager mit anderen Gefühlen und Assoziationen entgegen. Und es werden wundersame Feststellungen gemacht: die Menschen, die dort arbeiten, sind freundlich. Grund für einen Polen, Mißtrauen zu entwickeln. Das ist so nicht bekannt, was soll damit bezweckt werden?
Muszer weiß, daß die Eindrücke nicht mit der Realität übereinstimmen müssen, daß charakterliche Gegensätze in einer Person zum Ausdruck kommen können. Als auf dem Weg nach Hamburg der Held von Polizeibeamten auf der Autobahn aufgegabelt und zur nächsten Polizeiwache gebracht wird, kocht ihm ein Beamter, der „Mollige“, einen Kaffee. „Mollige“ sind freundlich, ja gemütlich. Der auch, aber als er erfährt, einen „Polacken“ vor sich zu haben, wird er ungemütlich und hält Naletnik seine Dienstwaffe an die Schläfe. Naletnik, gewitzt, kennt die Ängste der Deutschen und ihre Verpflichtung zur Korrektheit und so erwähnt er, daß er Jude sei. Grund genug für den geschockten „Molligen“, vor Freundlichkeit zu zerfließen und die lebensbedrohliche Szene ungeschehen zu machen. An Stellen wie dieser wird die unterschiedliche Denkkultur deutlich: in Deutschland das alternative Denken, entweder oder, man kann eben nicht ein bisschen schwanger sein, dort das additive Denken, daß seine Verwandtschaft zum mediterranen Raum nicht verleugnen kann. Alles geht, auch im Widerspruch, im Paradox. Polen liegt kulturell an der Adria und Don Camillo und Peppone könnten genauso gut polnische Charaktere sein.
Dem Autoren bereitet es sichtbar Freude, wenn voreilige Interpreten auf die Minen der Unwissenheit treten. Ob sich der Roman gegen irgend jemand richten würde, denn man könne die eine oder andere Stelle so und so verstehen. Die ängstliche Suche nach politisch korrekter Absicherung. Er amüsiert sich über jenes Staunen der Emigranten über gerade Bürgersteige, funktionierende Straßenlaternen und unversehrten Baumreihen, denunziert aber nicht, läßt sich nicht auf billige Vorwürfe ein. Aber er sagt deutlich: die Welt dürstet nach Lügen und nach Lügnern.
Das Buch ist nicht nur unterhaltsam, sondern führt uns mit schwarzem Humor und Sarkasmus das Podest vor, von dem dieses Land mit den Augen eines Emigranten aus dem Osten betrachtet werden kann. Er gibt uns die notwendige Außenansicht für die mögliche Revision unzulänglicher Innenansichten. Muszer ist ein genauer Beobachter und brillianter Analytiker. Grund genug, daß von ihm noch Großes zu erwarten ist. Und die Widersprüchlichkeit des Lebens spiegelt sich auf dem überaus gelungenen Cover wider: das Synonym der Freiheit, Vanillestangen, angeordnet wie der Kalender an der Wand einer Gefängniszelle. Muszer wurde kürzlich mit dem niedersächsischen Schriftstellerpreis ausgezeichnet.
Dariusz Muszer: Die Freiheit riecht nach Vanille, Roman. A1 Verlag, München, 216 Seiten


