Laudatio auf Dariusz Muszer
Vorgelesen am Sonntag, dem 28. November 1999 in Diepholz. Die Verleihung des Preises „Das neue Buch in Niedersachsen und Bremen“. Der Preis für das Jahr 1999 ging an Dariusz Muszer für seinen Roman „Die Freiheit riecht nach Vanille“, erschienen im A1 Verlag, München.
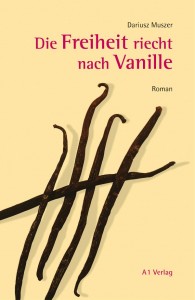 Wenn einer eine Tür hinter sich zuschlägt, entsteht ein Nachhall. Je nachdem, wie geräuschvoll, wie energisch man sie zuschlug, wird der Hall früher oder später verflogen sein. Man ist auf der anderen Seite der Tür, die Tür ist geschlossen, man hat ihr den Rücken zugekehrt und entfernt sich. Man hat einen Punkt gesetzt, hat Schluß gemacht, etwas hinter sich gelassen, hinter dieser Tür. Der Türknall war wichtig, um einem selbst und vielleicht auch anderen diesen Schluß deutlich zu machen. Der Türknall hat seinen Sinn, wenn er dem Schlußpunkt ähnlich ist, ein erschreckender, ein befreiender Augenblick, nicht mehr.
Wenn einer eine Tür hinter sich zuschlägt, entsteht ein Nachhall. Je nachdem, wie geräuschvoll, wie energisch man sie zuschlug, wird der Hall früher oder später verflogen sein. Man ist auf der anderen Seite der Tür, die Tür ist geschlossen, man hat ihr den Rücken zugekehrt und entfernt sich. Man hat einen Punkt gesetzt, hat Schluß gemacht, etwas hinter sich gelassen, hinter dieser Tür. Der Türknall war wichtig, um einem selbst und vielleicht auch anderen diesen Schluß deutlich zu machen. Der Türknall hat seinen Sinn, wenn er dem Schlußpunkt ähnlich ist, ein erschreckender, ein befreiender Augenblick, nicht mehr.
Das Buch von Dariusz Muszer beschreibt die Umkehrung dieses Sinnes, ein Weggehen, dessen Nachhall lauter wird. Er schwillt allmählich an, Woche für Woche, Monat für Monat, Jahr um Jahr – je länger der Weggeher hinter der zugeschlagenen Tür lebt, desto lauter wird in ihm, was er hinter sich lassen wollte. Es holt ihn ein, es springt ihn an in zufälligen Fernsehbildern, aus zufälligen Bekanntschaften, es ist überall gegenwärtig, hier, in der anderen Welt, wo er sich davor sicher wähnte. Der Held des Buches, dieser Naletnik kann sich seiner Vergangenheit nicht erwehren, er kann sie nicht verleugnen, nicht abschütteln, und wenn er glaubt, sie glücklich vergessen zu haben, steht sie plötzlich vor ihm und sieht ihn an wie eine lauernde Bestie. – Zuletzt wird er Frau und Kinder verraten, weil sie aus seinem Gestern stammen. Aber auch das hilft nicht, im Gegenteil, nun ist sie wieder ganz und gar bei ihm, die verdammte Vergangenheit: er ist wieder der Verräter, der er immer war, und keine Aussicht mehr, der bessere Mensch zu werden, der er hinter der zugeknallten Türe hatte werden wollen. Er ist der, der er immer war, er hat sich mitgenommen in die fremde Welt, er wird sich nicht entkommen und zuletzt an sich zugrunde gehen: an dem anschwellenden Gedröhn seiner Schuld. Das Dröhnen, die Drohung bricht erst ab, als dieser Naletnik am Ende ist mit sich und seiner Geschichte, als er sie gebannt hat auf die ihm mögliche Art: sie aufgeschrieben hat mit letzter Kraft – vor der Polizei, die ihn als Mörder sucht, versteckt in einem Hannoveraner Bunker. Hier erst wird es wieder still um ihn, das Manuskript, den Tod vor Augen.
Wenn einer die Welten wechselt, stellt er sich selbst in ein anderes Licht, so, wie er sich jetzt sehen muß, kannte er sich nicht, er muß sich neu kennenlernen. Wenn einer in der Lebensmitte die Welten wechselt, war er sich schon selbstverständlich, auch wenn die Welt, in der er lebte, ihm immer fragwürdiger geworden war. Daß er selbst ein Produkt dieser fragwürdigen Welt ist, kann er erst erkennen, wenn er sie verlassen hat. Er kann es nicht nur, er muß es. Muszers Held muß sich als „Außerirdischen“ erfahren; je tiefer er in die neue Welt eindringt, desto deutlicher wird ihm seine Fremdheit. Anschwellender Nachhall: Das Gewordensein wird in ihm groß, das Gestern, das nicht ins Heute passen will. Je länger er der alten Heimat fern ist, desto unheimlicher wird er sich selbst.
Als dieser Spätaussiedler Naletnik mit dreißig Jahren von Polen nach Westdeutschland kommt, steht der eiserne Vorhang noch, es sind noch zwei Welten. Er ist das Kind einer haltbar erstarrten Diktatur, die Kollision seiner Prägungen mit der westdeutschen Normalität der späten achtziger Jahre ist in diesem Buch exemplarisch beschrieben. Als Verräter wittert er überall Verrat, als Untertan haßt er auch die freundlichsten Beamten, auch die korrektesten Uniformierten, er will nicht wahrhaben, daß es keine verdammten Verhältnisse mehr gibt, die ihm erlauben, ein schlechter Mensch zu sein, denen er all seine Schuld, all seine Versagen aufhalsen kann. Er hat das Pech, seine diktatorischen Prägungen schmerzhaft deutlich zu erkennen und will nicht wahrhaben, daß er die Verantwortung für seine mißratene innere Gestalt nun plötzlich ganz allein auf seinen Schultern hat. Er will es nicht wahrhaben, daß er nun plötzlich frei ist, wirklich frei, schlimm frei, schwer, schmerzhaft frei. Erst jetzt kann er den Unfreien in sich erkennen und findet seinen Platz nicht, solang er sich nicht selbst gefunden hat. Seine Nische ist ein privater Warteraum mit Fernseher und Dosensuppen. Er kann in der Glotze verschwinden, sich abhanden kommen, seine Lage vergessen. Bis diese Bilder gesendet werden, die alten Bilder in einer Dokumentation, auf denen er sich wiedererkennt als ein Nachfahre von Mördern und Erschossenen.
Es ist eine Erschießungsszene aus der Zeit des Zweiten Weltkrieges, der eine kniet, er hat den Stern auf seinem Ärmel, der andere zielt mit dem Revolver, er trägt SS-Uniform. Naletnik schafft es, eine Kopie des Dokumentarfilms vom Sender zu bekommen, spult vor- und rückwärts, löst die Sequenz in Einzelbilder auf, dringt in die alte Szene ein, glaubt, seinen Großvater da zu entdecken, er recherchiert sich, was er finden will zurecht, als ließe sich in den undeutlichen Bildern endlich Antwort finden auf die Frage: wie bin ich so geworden, mir selbst so ungeheuerlich? Wer oder was hat mich so werden lassen, wie ich bin? In der Kiste mit alten Zeugnissen seiner deutschen Abstammung finden sich Fotos seiner männlichen Ahnen, und dieser Besessene schafft es tatsächlich, sich eine deutsch-jüdisch-sorbische Herkunft glaubhaft zu machen, die Verhängnis genug ist, Schicksal genug, um ihn als von Geburt Gezeichneten erscheinen zu lassen. Den Grund zum Bösen, den die Verhältnisse des Westens ihm verweigern, findet er schließlich in den eignen Genen. Und ist gerettet und in Sicherheit: in seiner alten Heimat, der Verdammnis.
Dariusz Muszer erzählt die Heimsuchungen der Freiheit, er erzählt, wieviel komischen, verzweifelten Aufwand man betreiben kann, sie nicht auf sich nehmen zu müssen, die vanillesüße, bittere Freiheit. Wie unerträglich sie sein kann, wenn man als ausgewachsener Untertan hineingeworfen wird. Und wie Geschichte, Herkunft, Schicksal zur moralischen Entlastung eines neunmalklugen Bösewichts herhalten können. – Ein Vorzug des Buches ist, daß von all diesem nicht die Rede ist. Der Weg des Spätaussiedlers durch die westliche Welt ist aus einer Innensicht geschildert, die seine Geschichte glaubhaft und spannend macht. Da taumelt einer wie im ständigen Delirium durch eine deutsche Großstadt, wie ein Raubtier immer gewaltbereit, immer bereit sich mit Fäusten zu wehren und sich zu nehmen was er braucht. Es ist die Sicht, die man nur um den Preis des sozialen Abstiegs und der Verrohung gewinnen könnte, es sei denn, ein Autor wie dieser beschriebe einem die eigene wohlbekannte Stadt von unten her, von daher, wo die hochzivilisierte Ebene nicht erreichbar scheint, obwohl doch immer gegenwärtig. – Der Bahnhof ist so ein Begegnungsort von oberer und Unterwelt. Dariusz Muszer schildert ihn als den Ort ewiger Ankunft. Auch wenn man hier über Jahre hin vom Betteln lebt, kann man das Gefühl haben, von der schönen, der wirklichen Welt nicht ausgeschlossen zu sein. Man darf sie bewohnen – die Passagen mit den schönen Auslagen. Man ist unter ihnen, Teil von ihnen, die hier geschäftig aus und ein fluten, man bräuchte ja nur wie sie den Bahnhof zu verlassen – und wäre angekommen… Den Romanhelden hält es nicht lang bei diesen Ankunftsillusionen, er macht sich auf den Weg, will ankommen in seinem neuen Leben. Er nimmt auf sich, was es bedeutet, daß da über Jahrzehnte mitten in Europa, wenige Zugstunden nur entfernt zwei so galaktisch getrennte Welten wachsen konnten. Er nimmt diesen Riß auf sich, läßt sich zerreißen von dem Riß, der durch Europa ging, er ist kein Feigling. Eher schon ein Masochist, ein gequälter Quäler, ein vaterloser Selbsthasser und Selbstverächter.
Freiheit heißt für ihn, von der Vergangenheit eingeholt zu werden, von Schuld und Selbsthaß in dem Maße, wie er sich als schuldfähiges Monster begreift. Daß das Gewesene und Gewordensein erst mit der Freiheit recht begriffen werden kann, macht die vanillesüße Freiheit bitter. Naletnik kann aus dem Teufelskreis des Bösen, das man ihm antat, nicht ausbrechen, und er hat das Pech, dieser Unfähigkeit auch noch ins Gesicht sehen zu müssen: ins eigene.
In seiner persönlichen Geschichte hallt das große Völkermorden nach, der männerschlingende Krieg, dessen verheerende Wirkungen auf die männliche Selbstachtung bis heute nachwirken. Naletniks Großvater könnte dieser SS-Mann sein oder der Jude, der vor ihm kniet. Sein Vater entzieht sich ihm, wie ein Vater sich seinem Sohn gründlicher nicht entziehen kann: er verleugnet seine Zeugung, lebt als schwuler Dandy in der Nähe und stirbt, bevor der Sohn ihn endlich findet. – „Entväterung“ heißt ein modernes Schlagwort, in diesem Buch bekommt es eine europäische Dimension: Die Untoten, die Gespenster des Nachkriegs, seine deutsch-slawisch-jüdischen Vorfahren stehen in Naletnik auf, diese Täter-Opfer sind ihm und sich zu vieles schuldig geblieben und können deshalb keine Ruhe finden. Ihre Aufritte als schwarze „Gefiederte“ wirken hier weniger schauerlich als tröstlich: Er ist mit seinem Selbsthaß nicht allein, der kommt von weiter her.
Der anschwellende Nachhall dieses Buches ist also ein allgemeinerer: Das vor zehn Jahren gen Westen aufgestoßene Tor hat die Vergangenheiten freigelassen. Das Grauen, die Schuld, das Böse gewinnen an Faszination. Naletnik ringt mit den in ihm aufstehenden Mächten des Bösen wie ein moderner Herakles. Er unterliegt. Tröstlich ist, daß er nicht als Gespenst umgehen wird, er hat gesühnt, hat sich erlöst im Leben und kann ruhig sterben.
Die krude Sprache dieses Buches tanzt die Verrücktheit, Rohheit, unserer Geschichte, sie scheint mir angemessen für das harte Sterben dieses Einen, der sich alles Elend des Jahrhunderts auf den eigenen Hals geladen hat. Es ist ein bitter-böses Buch, das gleichwohl ein lautloses, trockenes Lachen evoziert über den deplazierten Mann-Mann, der so ganz Mann sein will, daß er im androgyn verschwommenen Westen meistens komisch wirkt. Ein Urgestein von Mann, ganz unverzärtelt, in seinem Mannsein ungebrochen, wird zur tragikomischen Figur, weil ihm sein Männerstolz verbietet, einmal, nur ein einziges Mal zu weinen.
Dariusz Muszer: Die Freiheit riecht nach Vanille, Roman. A1 Verlag, München, 216 Seiten


