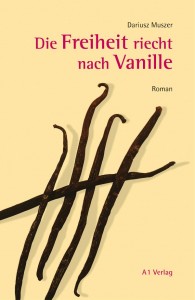 Mit einer Vorspeise beginnen die Feinschmecker das Essen. Womit soll man die Lektüre eines Romans schmackhaft machen? Dariusz Muszer hat seine Antwort auf diese Frage. Schon im Titel macht er einen Hinweis auf den kulinarischen Bezug. Das erste Kapitel seines Romans, „Vorspeise“, beginnt mit einem Zitat aus dem „Hunger“ von Knut Hamsun. Folglich serviert der Ich-Erzähler den Rahmen seiner Geschichte und stellt sich mit diesen Worten vor: „Ich bin das kleinste schwarze Arschloch im Universum. Seit meiner Geburt verschlinge ich alles, was mir in die Finger kommt, sogar mich selbst.“ So wie am Tisch die Vorspeise den ersten Hunger stillt und uns auf das Hauptgericht neugierig macht, so macht der Erzähler einen Vorgeschmack auf seine kuriose und dekadente Erzählung.
Mit einer Vorspeise beginnen die Feinschmecker das Essen. Womit soll man die Lektüre eines Romans schmackhaft machen? Dariusz Muszer hat seine Antwort auf diese Frage. Schon im Titel macht er einen Hinweis auf den kulinarischen Bezug. Das erste Kapitel seines Romans, „Vorspeise“, beginnt mit einem Zitat aus dem „Hunger“ von Knut Hamsun. Folglich serviert der Ich-Erzähler den Rahmen seiner Geschichte und stellt sich mit diesen Worten vor: „Ich bin das kleinste schwarze Arschloch im Universum. Seit meiner Geburt verschlinge ich alles, was mir in die Finger kommt, sogar mich selbst.“ So wie am Tisch die Vorspeise den ersten Hunger stillt und uns auf das Hauptgericht neugierig macht, so macht der Erzähler einen Vorgeschmack auf seine kuriose und dekadente Erzählung.
Wir treffen ihn in einer Situation des Schreibens an. Er sitzt, gesundheitlich angeschlagen, eingesperrt irgendwo in Hannover und schreibt an seiner Lebensgeschichte. Sie ist ein Teil des Vertrages, den er mit K.K., dem wahren Mörder und Geschichtenjäger, unterschrieb. Im Gegenzug wird der Wunsch des Erzählers zu sterben erfüllt. Von den Medien wird er für einen Massenmörder gehalten. Sich selber bezeichnet er als einen Außerirdischen, der vor 37 Jahren durch einen ungeplanten Sturz in Südnorwegen auf die Erde kam und von einer Polin auf einem sorbischen Opferstein geboren wurde: “Zufällig lag der Stein an der Oder, genau an der heutigen deutsch-polnischen Grenze, allerdings auf der polnischen Seite. War das nur Pech oder Glück? Hundert Meter weiter westwärts wäre meine Kindheit ganz anders verlaufen und ich ein anderer Mensch geworden.“ Der Erzähler verbringt seine Kindheit in Polen. Später, Ende der 80er Jahre, reist er nach Deutschland aus, was den zentralen Punkt des Romans darstellt, quasi das Hauptgericht. Das erste was er in Deutschland wahrnimmt, nachdem er aus dem Zug ausgestiegen war, ist der Vanillegeruch. Dieser Geruch, der auch zum Duft wandelt, begleitet den Erzähler durch seine ganze Geschichte, bis hin zu den letzten Zeilen des Romans und zugleich zu den letzten Minuten seines Lebens.
Der arrogante und unverschämte Ich-Erzähler, der auf dem Leser den Eindruck eines naiven „Erdlings“ macht, entpuppt sich als ein scharfer Beobachter seiner Umgebung, sowohl der polnischen als auch der deutschen. Geprägt durch die polnische Kultur und Vergangenheit, von der er flieht, die ihn aber einholt, lässt er sich zu einem Deutschen machen, um ein neues Leben in Hannover anzufangen.
Nach der Ankunft im Land des Wirtschaftswunders verbringt er die ersten Tage am hannoverschen Bahnhof. Dort ausgeraubt, befreundet er sich mit dem Dieb, der ihm das Leben in Hannover näher bringt. Der Traum vom besseren Leben in Deutschland findet keine Erfüllung. Der Erzähler sucht sein Glück, mit Hoffnung auf bessere Zukunft, auf der offiziellen Ebene. Wie er sagt, ist Friedland „ein Lager der besonderen Art. Man nennt es bescheiden und phantasielos das Grenzdurchgangslager. Ich würde es ganz anders nennen (…). ‚Schattige Eiche‘ wäre nicht schlecht und obendrein echt germanisch. Man vernichtet dort keine Menschen, jedenfalls nicht im Sinne, wie man das früher, in jüngster Geschichte , gemacht hat. (…) Friedland ist ein Lager, in dem man aus normalen, gewöhnlichen Menschen, zur Zeit hauptsächlich aus dem östlichen Europa und Asien, richtige Deutsche macht, egal, wer du bisher, also eigentlich dein ganzes Leben lang, warst. Gehst du als Russe, Litauer, Pole, Rumäne oder Kasache hinein, kommst du als Deutscher wieder heraus. Man produziert dort Deutsche haufenweise! Und es ist gut so.“ Die Provokation und Ironie des Erzählers mag manches Ohr schockieren und unverständlich erscheinen. Es ist in der Tat eine ungewöhnliche und bis jetzt nicht praktizierte Art der Verarbeitung der politischen und gesellschaftlichen Umstände.
Tragisch wird die Geschichte seiner Frau, die er in Polen mittellos mit zwei Kindern hinterlässt. Sie kommt ihm jedoch nach und auf einmal muss sich der Erzähler, der zur Zeit ohne Job ist, um die Kinder und die Frau kümmern. Als er endlich eine Beschäftigung findet, hält er den Druck der Situation nicht mehr aus. Er sperrt die Familie in der Wohnung ein und wirft den Schlüssel weg. Einige Zeit später erfahren wir, dass die Polizei drei Leichen in einer Wohnung aufgefunden hat, zwei Kinder und eine Frau. Alle drei brutal ermordet. Wir wissen, dass die Tat nicht vom Erzähler begangen worden ist. Wir ahnen wer der Mörder ist. Jetzt spielt Muszer schon wieder mit den Emotionen und Gefühlen des Lesers. Er zwingt zum Überlegen und zum Bewerten, wobei er zugleich den Boden entzieht und dem Leser keine Chance gibt eine eindeutige Position zu beziehen.
Komplizierter wird seine Situation, wenn sich herausstellt, dass er einen jüdischen Vater und eine Schwester hatte. Die Suche nach dem Vater und der Tod seines Freundes, Skunk die Karotte, bringt ihn näher an die Welt der „Gefiederten“ an die er sich freiwillig anschließen wird. Entgegen der konservativen Idee einer Heimat und eines Ursprungs, verkörpert Muszer in seinem Erzähler nicht nur die Idee sondern die Tatsache der Multikulturalität: “Ich will auf jeden Fall vermeiden, daß man mich dort oben fälschlicherweise für einen echten Germanen hält. Ich bin nur ein Mischling, ein slawisch-germanisch-jüdischer Köter, der den Weg eines Außenirdischen gewählt hat, um zu überleben.“
Das Spiel mit den Stereotypen und Vorurteilen über andere Nationalitäten und Völker führt zu ihrer Aufhebung. Die Art und Weise, wie Muszer die Problematik der Multikulturalität und Vergangenheitsbewältigung durch den Erzähler präsentiert, kann manche schockieren. Nach dem der Erzähler in Friedland seinen Registrierschein bekommen hatte und nach einem bestimmten Ort zugewiesen worden war, schreibt er: “Ich entschloß mich, anders zu handeln als verlangt. Blöd bin ich ja, aber so blöd, alles zu tun, was die deutsche Regierung von mir erwartet, bin ich nun auch wieder nicht. Noch in Polen hatte ich unzählige Geschichten über Menschen gehört, die das taten, was die Deutschen wollten. Ihnen war das nicht besonders gut bekommen, besonders denen nicht, die auf Befehl mit dem Zug gefahren waren, ohne Rückfahrkarten, aber mit Pelzen und goldenen Zähnen.”
Auch von der Arroganz der Welt, in die der Erzähler geworfen wurde, ist die Rede. Bei dem Job, den er nach einer sehr langen Suche findet, nennen ihn die Chefs: Wodka, und seinen jugoslawischen Kollegen: Sliwowitz, da ihre slawischen Namen zu kompliziert und fremd klingen, um sie richtig auszusprechen, geschweige erst sie zu sich zu merken.
Die unverblümte Direktheit des Erzählers, die keine Vulgarismen scheut, wird durch seine klare Sprache verstärkt. Durch die kurzen Sätze gewinnt der Text einen besonderen Rhythmus, welcher der Ausgangssituation getreu bleibt. Der körperlich zusammengebrochene Erzähler hat nur sechs Monate Zeit, um sein Werk zu vollbringen. Deswegen muss seine Erzählung knapp und kondensiert geschrieben werden. Mit viel Selbstironie und Humor legt er das letzte Zeugnis seines Daseins.
Selten liest sich ein Buch, das so schwere Problematik aufwirft, mit der Leichtigkeit und dem Lächeln auf den Lippen wie das Buch von Muszer. Auch wenn die Nachspeise, das abschließende Kapitel dieses Romans, Ekelgefühle hervorruft, hinterlässt die gesamte Lektüre keinen unangenehmen Nachgeschmack.
Die Besonderheit des Romans besteht nicht nur darin, dass es sich um ein sehr gutes erzählerisches Handwerk von Dariusz Muszer handelt, sondern, dass Muszer der einzige polnische Autor der 80er Emigration ist, der auf deutsch schreibt.
© Katarzyna Rogacka-Michels
Dariusz Muszer: Die Freiheit riecht nach Vanille, Roman. A1 Verlag, München, 216 Seiten


