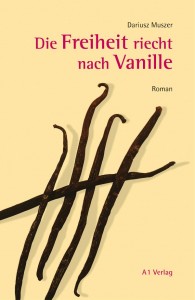 Man hat mich gebeten, für Dariusz Muszer eine kurze Einführung zu machen, für seine Lesung in Bremen. Erst einmal ein paar biographische Daten vorab: Muszer wurde 1959 in Westpolen geboren, studierte Jura, hatte diverse Jobs ausgeübt und lebt seit 1988 in Hannover als polnischer und deutscher Autor – das ist mit Texten in beiden Sprachen. »Die Freiheit riecht nach Vanille« ist sein erster Roman in deutscher Sprache; er erschien 1999 im Münchener Verlag A1 und wurde im selben Jahr mit dem Literaturpreis des Deutschen Schriftstellerverbandes »Das neue Buch in Niedersachsen und Bremen« ausgezeichnet. »Die Freiheit riecht nach Vanille« wurde bundesweit besprochen, was für den kleinen Verlag A1 eine zusätzliche Auszeichnung ist.
Man hat mich gebeten, für Dariusz Muszer eine kurze Einführung zu machen, für seine Lesung in Bremen. Erst einmal ein paar biographische Daten vorab: Muszer wurde 1959 in Westpolen geboren, studierte Jura, hatte diverse Jobs ausgeübt und lebt seit 1988 in Hannover als polnischer und deutscher Autor – das ist mit Texten in beiden Sprachen. »Die Freiheit riecht nach Vanille« ist sein erster Roman in deutscher Sprache; er erschien 1999 im Münchener Verlag A1 und wurde im selben Jahr mit dem Literaturpreis des Deutschen Schriftstellerverbandes »Das neue Buch in Niedersachsen und Bremen« ausgezeichnet. »Die Freiheit riecht nach Vanille« wurde bundesweit besprochen, was für den kleinen Verlag A1 eine zusätzliche Auszeichnung ist.
In allen Zeitungskritiken zu Muszers Erstling, die ich gelesen habe, fällt folgendes auf: Der Ich-Erzähler Natelnik, der in Hannover lebt und dort als Massenmörder grassiert und von K.K., einem berühmten deutschen Autor terrorisiert wird, soll in sich so einige Attribute einer Figur aus dem Schelmenroman, wie wir ihn von Döblin, Grass oder Bukowski im 20. Jh. kennen, vereinigen – er provoziere, er sei weder Pole noch Germane, sondern ein Bastard aus dem Schwarzen Loch, ein bekloppter Außerirdischer, er lebe dort, wo es ihm gefällt, nämlich auf der Straße, er sei aber kein Emigrant, und er sei ein sorbisch-deutsch-jüdischer Mischling, ein Ungeziefer, eines, das sich im Spätaussiedlerlager in Friedland habe germanisieren lassen, also ein Volksdeutscher, und Natelnik dürfe man auf keinen Fall mit Muszer identifizieren usw.. Die Aufzählungen und Deutungen, was dieser Ich-Erzähler alles sei, nehmen kein Ende. Eine Art intellektuelle Ratlosigkeit macht sich breit, und der Leser wird verrückt.
Ich glaube, dass Dariusz Muszer eine Falle aufgestellt hat, die symbolisch ist und einer feinen, delikaten Interpretation bedarf. In erster Linie lese ich seinen Roman als eine Art Deklaration, und die lautet: Es ist absurd, dass wir Schriftsteller in unseren nationalen Sprachen nach Identifikation suchen – es ist absurd, aber gleichzeitig notwendig. Was wird jedoch aus Autoren, deren fundamentale Existenz, nämlich in ihrer Muttersprache, durch private und geschichtliche Umstände zerstört wird? Wenn ihre Namen und Biographien durch die große Hegelsche Geschichte manipuliert und ausverkauft werden? Werden sie dann wirklich zu Ufonauten, die plötzlich in einem Raumschiff um die Erde gondeln und ihre Bewohner, die Erdlinge, sich als Schauspieler eines grotesken Theaters ansehen? Ich glaube ja.
»Die Freiheit riecht nach Vanille« erzählt viel mehr die Geschichte eines Hundes, der bellt und daran glaubt, dass er wirklich ein Hund ist. Es ist wieder keine neue Geschichte, und das ist gut so; der Schöpfer des Universums Krishna erzählt sie auch dem tapferen Krieger Arjuna. Aber vielleicht hat diese alte Story eine besondere Aktualität in unseren ultramodernen Zeiten, die so viele grauenvolle Stammeskriege hervorgebracht haben und leider weiter hervorbringen, und das letzte Beispiel des sinnlosen Abschlachtens ist uns allen in Europa gut bekannt.
Insofern betrachte ich Muszers Buch als eine Art Protest gegen diese Selbstverständlichkeit, mit der wir Erdlinge unsere nationalen Geburtszeugnisse, Ausweise und Gene für diverse Interessen einsetzen und ausnützen. Wir sind doch keine Hunde, auch wenn wir manchmal bellen. Auf dieser Spur müsste man weiterforschen, und da hilft nur eines: Lesen Sie bitte Muszers Buch.
Einführung zur Lesung, Bremen, 14.2.2001
© Artur Becker
Dariusz Muszer: Die Freiheit riecht nach Vanille, Roman. A1 Verlag, München, 216 Seiten


