Das Romandebüt des deutsch schreibenden Polen Dariusz Muszer
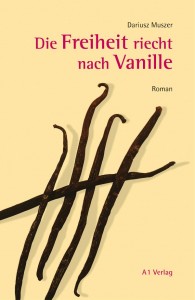 Vor etwa hundert Jahren tauchte unter den Berliner Bohemiens ein polnischer Schriftsteller namens Stanislaw Przybyszewski auf und avancierte alsbald zur literarischen Sensation. Nicht allein, dass er der herrschenden düsterdekadenten Mode eine eigene Note hinzufügte; es gelang ihm auch, die deutsche Sprache, in der er nun seine satanischen Romane und Dramen verfasste, neu erklingen zu lassen: sie zu „chopinisieren“, wie sein Freund Richard Dehmel sagte. Heute werden die Dinge nüchterner betrachtet. Zwar hat ein deutsch schreibender Pole immer noch einen Seltenheitswert, er kann auch durchaus einen Begeisterungssturm auslösen (der aspekteLiteraturpreisträger Radek Knapp ist das beste Beispiel), doch zur wahren literarischen Sensation braucht es offenbar etwas mehr als sprachliche Fitness und inhaltliche Originalität.
Vor etwa hundert Jahren tauchte unter den Berliner Bohemiens ein polnischer Schriftsteller namens Stanislaw Przybyszewski auf und avancierte alsbald zur literarischen Sensation. Nicht allein, dass er der herrschenden düsterdekadenten Mode eine eigene Note hinzufügte; es gelang ihm auch, die deutsche Sprache, in der er nun seine satanischen Romane und Dramen verfasste, neu erklingen zu lassen: sie zu „chopinisieren“, wie sein Freund Richard Dehmel sagte. Heute werden die Dinge nüchterner betrachtet. Zwar hat ein deutsch schreibender Pole immer noch einen Seltenheitswert, er kann auch durchaus einen Begeisterungssturm auslösen (der aspekteLiteraturpreisträger Radek Knapp ist das beste Beispiel), doch zur wahren literarischen Sensation braucht es offenbar etwas mehr als sprachliche Fitness und inhaltliche Originalität.
So weckt der auf deutsch verfasste Erstlingsroman des Polen Dariusz Muszer, „Die Freiheit riecht nach Vanille“, zwiespältige Gefühle. Der Autor, ein 1959 in Westpolen geborener und in unzähligen Gelegenheitsjobs erprobter Jurist, siedelt die Handlung in Hannover an, in der „Stadt der Untoten,“, wo er seit 1988 lebt. Auch sonst gibt es einige Gemeinsamkeiten zwischen ihm und seinem Ich-Erzähler.
Das Buch ist nämlich die Geschichte eines polnischen Auswanderers, genauer: „eines sorbisch-deutsch-polnisch-jüdischen Mischlings“, und um ganz genau zu sein: eines Außerirdischen, der statt in Südnorwegen irrtümlich in Polen gelandet ist und nun, Ende der achtziger Jahre, nach Deutschland kommt. Dass er ausgerechnet in Hannover sein neues Domizil findet, verdankt er nur einer falsch gelösten Fahrkarte, doch sobald er den Zug verlässt, wird er für seinen Irrtum entschädigt: „Draußen merkte ich sofort, wonach die Freiheit roch. Sie roch nach Vanille. Der bezaubernde Duft zog mich an.“
Alles andere ist weniger bezaubernd, zumal sich seine Wege bald mit denen eines Massenmörders kreuzen. Der Erzähler, der die Opfer kannte, ist von vornherein einer der Hauptverdächtigten; als seine Familie in seiner Wohnung ermordet aufgefunden wird, ist ihm Hannovers Polizei endgültig auf den Fersen. Dank seiner dubiosen Verbindungen findet er jedoch ein Versteck, in dem er, auf Drängen des eigentlichen Mörders, sein Buch schreibt. „Ich bin das kleinste schwarze Arschloch im Universum. Seit meiner Geburt verschlinge ich alles, was mir in die Finger kommt, sogar mich selbst.“ So beginnt er seine Geschichte, die lange nicht so unkompliziert ist, wie es scheint Denn da gibt es auch noch zwei Großväter, einen nichtjüdischen und einen jüdischen, von denen der eine den anderen erschossen haben soll, eine Schwester, die 1968 Polen verlassen hat und nun plötzlich in seinem Leben auftaucht, einen Vater, der mal ein verschollener polnische Zirkusakrobat, mal ein in Hamburg lebender Jude ist, eine Mutter, die eine kriminelle Vergangenheit hat oder auch nicht… Irgendwann scheint der Erzähler selbst vor dem Ereigniskarussell zu kapitulieren. „Was wird hier wirklich gespielt, können Sie mir das vielleicht erklären?“ Diese Frage möchte man auch ihm mehr als einmal stellen.
Das Buch will nicht nur ein Krimi und ein modernes Märchen sein. Es hat auch kritisch-satirische Ambitionen, wobei Muszer weder mit der alten Heimat zimperlich umgeht („Solche Ungeheuer, nur annähernd ähnelten sie der Menschenrasse, kann man im Osten haufenweise treffen“, beendet er die Beschreibung einer Slawin) noch dem System Bundesrepublik, in dem man „zuerst an die Sauberkeit und dann an die Menschen“ denke, satirische Seitenhiebe erspart. In Friedland, dem Lager für Spätaussiedler, wird sein Held zwar selbst ein Teil dieses Systems; als beglückend empfindet er das aber keineswegs: „Ein ungeheures Ungeziefer war ich schon lange, bevor ich nach Friedland kam.“ Nun „bin ich ein perfektes Geschöpf geworden. Ein Ungeziefer deutscher Herkunft.“
Muszers Roman ist durchaus, wie der Klappentext verspricht, eine „skurrile, manchmal makabre Geschichte“, der man weder Spannung noch Witz absprechen kann. Und doch zieht er einen nicht so recht in seinen Bann. Liegt es womöglich daran, dass vieles in dem Buch von dem Hinweis, schuld an dessen Entstehung sei ein Rabbi aus Martin Bubers „Erzählungen der Chassidim“, über die jedem Kapitel vorgestellten Motti, bis zu den einzelnen Pointen allzu sehr auf einen sicheren Effekt bedacht zu sein scheint? An der etwas zu ereignisreichen Handlung, die man statt mit Neugier mit einer gewissen Anstrengung verfolgt? An den Kostproben polnischen Witzes, die ein wenig deplatziert wirken? Oder vielleicht einfach nur an der seltsamen Kälte, die von dem Roman ausgeht und das Universum, die Heimat des „kleinen Arschlochs“, noch erschreckender als sonst erscheinen lässt?
Süddeutsche Zeitung, Nr. 276, 29. November 1999
© Marta Kijowska, Süddeutsche Zeitung
Dariusz Muszer: Die Freiheit riecht nach Vanille, Roman. A1 Verlag, München, 216 Seiten


