Krass wie Grass: Muszer
Dariusz Muszers Geschichte ist ein einziger Wutschrei der politischen Inkorrektheit. Dabei erleichternd wie ein fantasievoller Fluch oder ein lang anhaltender Furz; dreist und deftig erzählt und eminent unterhaltsam. Das wirkt unbekümmert niedergeschrieben. Ein Eindruck, den nur hervorrufen kann, wer sich seiner artistischen Fähigkeiten sehr sicher ist. Das Buch könnte in Rage versetzen, wäre da nicht seine unglaublich dichte, klare und poetische, nie jedoch poetisierende Sprache.
Einer wie Oskar
„Ich bin das kleinste schwarze Arschloch im Universum.“ So charakterisiert sich der deutsch-polnisch-sorbisch-jüdische Ich-Erzähler gleich im ersten Satz, und man muss sich erst einmal daran gewöhnen, dass da einer vom Schlage Oskar Matzeraths die Szene betritt, ein Haarmann mit der Blechtrommel sozusagen. Eine Kunstfigur, mit der man sich weder identifizieren kann noch soll, aber die in ihrer scheinbaren Unwirklichkeit mehr von der Wahrheit einer finsteren Zeit und eines kalten Landes wiedergibt, als es noch so böse Wirklichkeitsbeschreibungen vermögen.
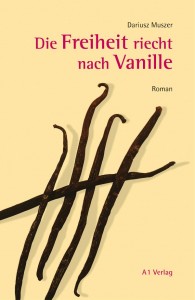 Auf einem sorbischen Grabstein rutscht der Erzähler in diese Welt, von einer Mutter entbunden, die ihn sofort umbringen will und die er vom ersten Atemzug an hasst. Gezeugt worden war er in einem Akt der Vergewaltigung, was ihn auch nicht eben für den Vater einnimmt. Außerdem stammt er von einem Großvater mütterlicherseits ab, der den Großvater väterlicherseits im 2. Weltkrieg durch Kopfschuss umgebracht hat.
Auf einem sorbischen Grabstein rutscht der Erzähler in diese Welt, von einer Mutter entbunden, die ihn sofort umbringen will und die er vom ersten Atemzug an hasst. Gezeugt worden war er in einem Akt der Vergewaltigung, was ihn auch nicht eben für den Vater einnimmt. Außerdem stammt er von einem Großvater mütterlicherseits ab, der den Großvater väterlicherseits im 2. Weltkrieg durch Kopfschuss umgebracht hat.
Und nun erinnert sich dieser Mann an 37 Jahre elenden Lebens, zuerst verbracht in Polen, dann im Nachwende-Deutschland. „Abschaum der deutschsprachigen Menschheit, das unterste Zehntausend, die High-Society der Arbeitslosen und Sozialhilfeempfänger: wir, Ausländer, Aussiedler, vergessene Abfälle der germanischen Herrenrasse. Und es war gut so. Wir passten zueinander, wie Scheiße zum Klo. Und wir alle wussten, wie man den Spülkasten bedient.“ Der Hass dieses Ekelpaketes hat die reinigende Kraft eines Gewitters.
Hier lässt sich studieren, wie meilenweit entfernt die Kraftmeiereien vieler junger Autoren vor der ohnmächtigen Wut eines Mannes sind, der schon viele Seiten des Lebens kennen, gelernt hat. Der Staatsanwalt und Dachdecker gewesen ist, Taxifahrer und Musikant, Schauspieler und Totengräber. Er besitzt den Grobianismus Charles Bukowskis und den schrägen Humor des frühen, anarchischen Günter Grass.
Horror-Hannover
Hannoveraner freilich werden ihm nicht so gerne zuhören wollen, denn ihre „Stadt der Untoten“ bekommt kräftig Fett weg: „Eine Stadt, die niemals schläft, aber immer schläfrig ist. Es ist eine Stadt wie die Menschen von heute: ohne Eigenschaften, ohne Charakter, ohne Gesicht“. In einem Traum fackelt der Held sie sogar mit dem Flammenwerfer ab.
Neue Presse, 27. November 1999
© Klaus Seehafer, Neue Presse
Dariusz Muszer: Die Freiheit riecht nach Vanille, Roman. A1 Verlag, München, 216 Seiten


