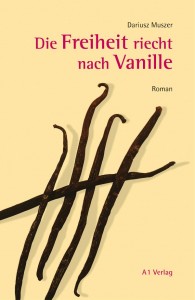 Manchmal werden wichtige Bücher einem zugespielt, und ich drehe und wende sie dann immer noch einige Zeit durch die Papierstapel auf meinem Schreibtisch, bis sie sich z.B. durch auffälliges Herunterfallen oder aufsässiges „im Weg liegen“ nicht mehr weiter ignorieren lassen und gelesen werden müssen. Spätestens danach bin ich zerknirscht und will mich beim Autor, dem Verlag, ja, bei dem Buch selber für meine anfängliche Ignoranz entschuldigen.
Manchmal werden wichtige Bücher einem zugespielt, und ich drehe und wende sie dann immer noch einige Zeit durch die Papierstapel auf meinem Schreibtisch, bis sie sich z.B. durch auffälliges Herunterfallen oder aufsässiges „im Weg liegen“ nicht mehr weiter ignorieren lassen und gelesen werden müssen. Spätestens danach bin ich zerknirscht und will mich beim Autor, dem Verlag, ja, bei dem Buch selber für meine anfängliche Ignoranz entschuldigen.
Eine weitere Möglichkeit ist, ich kenne den Autor, die Autorin, und schiebe einen Termin mit ihnen schon geraume Zeit wie einen imaginären Papierstapel vor mir her, endlich kommt es dann zu einer Gelegenheit, das lang versprochene Treffen kommt zustande und wieder könnte ich mich dann manchmal dafür ohrfeigen, da nicht schon längst tätig etwas angeschoben zu haben.
So ähnlich ergeht es mir mit Dariusz Muszer, vor einem Jahr anlässlich eines erfolgreichen Studiogespräches mit Oskar Ansull werden ich Dariusz vorgestellt, erfahre, er ist nicht nur Mitglied in unserer Polenflugredaktion, die für Radio Flora das polnische Programm macht, er hat Oskars Gedichte ins Polnische übertragen, schreibt selber Lyrik und Prosa und wird sofort von mir eingeladen, an einer Sendung teilzunehmen. Und dann vergeht mehr als ein Jahr, bis es endlich dazu kommt, mich mal etwas mehr mit seinen wenigen in deutsch vorliegenden Arbeiten zu beschäftigen, ich soll sogar zu einer Lesung kommen, irgendwo am Stadtrand, mache mich sogar pünktlich auf den Weg, aber das Auto bleibt stehen, kein Benzin, dann gibt es zwei Kulturtreffs und wir fahren natürlich zuerst zu dem falschen und als wir dann endlich eintreffen ist die Lesung beendet und Dariusz gibt mir mit skeptischen Blick eine Diskette mit seinem neuesten Roman, der in deutsch für Deutsche geschrieben ist und aus dem er gerade Auszüge vorgetragen hat. Diesmal habe ich mich aber gleich an die mühevolle Arbeit des Lesens gemacht und als ich mich 6 Stunden später etwas verwirrt wieder auf meinem Bett wiederfand, wusste ich zumindest eines: hier war ich eben einem großen Schelm und Schlitzohr aufgesessen, und ich war mir so überhaupt nicht im Klaren, war es nur die Romanfigur oder – untrennbar davon –, der Autor Dariusz Muszer dahinter, der mich so narrte.
Das Buch heißt „Die Freiheit riecht nach Vanille“ und wird im Spätsommer des Jahres in einem Münchener Verlag erscheinen. Auszug: „Ich bin das kleinste schwarze Arschloch im Universum. Seit meiner Geburt verschlinge ich alles, was mir in die Finger kommt, sogar mich selbst.“ So fängt die Vorspeise dieses seltsamen sorbisch-slawisch-deutschen Menüs an und angerichtet wird es überwiegend in Hannover. Geschildert wird die Odyssee eines Außerirdischen auf der Flucht vor den Fallenstellern einer düsteren menschlichen Realität, einer Flucht aus Polen, vor seiner Familie, vor dubiosen Geheimdienstlern. Es ist aber auch die Suche nach seiner Herkunft und obendrein, nach dem gelobten Deutschland, was ihn umtreibt, und eine Suche nach einem anonymen Mörder, der immer dann direkt in der Nachbarschaft zuschlägt, wenn unser Protagonist gerade mal wieder kein Alibi hat.
Für den Leser wird dieser Alptraum kaum erträglicher durch den gepfefferten schwarzen Humor, mit dem dieser panslawische Schwejk sich über den ganz alltäglichen Wahnsinn hinweghilft, spätestens bei der Schilderung seines trauten Ehealltags und den seltenen erotischen Konfrontationen mit seiner jüdischen Ehefrau will man das Skript am liebsten an die Wand werfen und liest dann doch völlig gebannt weiter.
Dariusz Muszer lässt seinen Helden sich selber schreiben, das Storybord entwickelt sich parallel zu Leben, Lust und Leiden und Recherche nach der Herkunft. Zum Ende bereitet er, den die geflügelten Bewohner aus dem Schwarzen Loch bei seiner Geburt fälschlich auf einem sorbischen Grabstein zur Welt kommen ließen, sich 37-jährig auf den Rückflug vor, damit er endlich in Südnorwegen wiedergeboren werden kann. Dazwischen sieht sich der Leser, dank der sprachgewaltig-epischen Darstellungsfähigkeit des Autors, eingespannt in diesen unfreiwilligen Reiseschelmenroman und empfindet trotz des grenzenlosen Machismo seines närrischen Antihelden am Ende sogar so etwas wie Verständnis und Liebe für ihn. Das braucht es aber auch, denn Muszer geht hart mit Hannover und seinen Ureinwohnern ins Gericht und die Schilderung des Durschnittsalltags eines Einwanderers hier, vor unser aller verschlossenen Augen, lässt einem mitunter den Ekel vor sich selbst hochsteigen.
Es ist da ein notwendiges Buch für diese Stadt und gegen den blinden Umgang ihrer Bewohner gegenüber allem unvorhergesehenen, fremdartigen entstanden und darüber hinaus eine lehrreiche Rede an die deutsche Bevölkerung obendrein, selbst wenn es der Autor seinen Lesern an keiner Stelle leicht macht ihn zu mögen. Aber dass sollen sie ja auch nicht wirklich, es würde schon genügen, sich ein bisschen mehr mit ihm zu beschäftigen.
Radio Flora, LiteraturSpezial, 14. Februar 1999
© Johannes Schulz
Dariusz Muszer: Die Freiheit riecht nach Vanille, Roman. A1 Verlag, München, 216 Seiten


