Dariusz Muszer las in Marburg
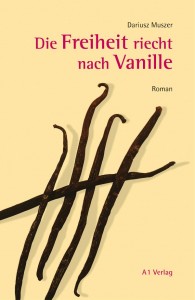 „Eigentlich ist Hannover genauso wie Posen, nur der Frühling ist halt zwei Wochen früher da.“
„Eigentlich ist Hannover genauso wie Posen, nur der Frühling ist halt zwei Wochen früher da.“
Wenn Dariusz Muszer seine Biografie reflektiert, tut er das nicht ohne einen lakonischen Unterton. Fast so, als wären jene aufregenden Szenarien, die da vom bundesdeutschen Feuilleton immer wieder aufs Tableau gehoben werden, nun wirklich nicht der Rede wert.
Gut, in Polen wurde der studierte Jurist 1985 mit einem Berufsverbot belegt. Seine Ausreise nach Hannover wenige Jahre später war zu Zeiten, in denen die Löcher im eisernen Vorhang noch keine wirklich beachtliche Größe erreicht hatten, auch kein Pappenstiel.
Doch Dariusz Muszer tut gut daran, sich nicht von solch biografischen Koordinaten vereinnahmen zu lassen.
Seit 1988 lebt er nun in der niedersächsischen Landeshauptstadt… und im vielzitierten Spannungsfeld zwischen zwei Kulturen. Doch ähnlich dem in Kiel lebenden türkischen Autor Feridun Zaimouglu fischt er nicht in den seichten Gewässern einer multikulturellen Völkerverständigung. Lieber teilt der 41-Jährige ein paar Tiefschläge aus; gegen Polen, Hannoveraner und den Deutschen an sich.
Letzterem begegnet der Ich-Erzähler seines Romans „Die Freiheit riecht nach Vanille“ zum Beispiel in der Person des feisten Autobahnpolizisten Horst. Als „Polakenschwein“ ausgemacht, hält Horst Muszers Protagonisten erst einmal die Dienstpistole an die Schläfe. Pech nur für Horst, dass sich jenes „Polakenschwein“ kurzerhand als Jude outet. Nur eine strategische Finte zwar, aber auf einmal wird der Autobahnpolizist wieder zum Freund und Helfer.
Nicht nur jener Polizeibeamte, auch Dariusz Muszers Romanheld bleibt über weite Strecken eine verdorbene Person. Eine Tatsache, mit der sich der Literat natürlich in einen klassischen literaturwissenschaftlichen Konflikt begibt. „Natürlich bin das nicht ich, obwohl, manchmal bin das natürlich ich“, bleibt Dariusz Muszer vor 50 Zuhörern im „Auflauf“ auch hinsichtlich der Frage nach der Authentizität seines Ich-Erzählers eindeutig uneindeutig.
Der Wahl-Hannoveraner („eine Stadt die niemals schläft, aber immer schläfrig ist“) macht es Lesern wie Zuhörern kaum leicht, obwohl er andererseits von eben denen ganz exakte Vorstellungen hat: „Ich wollte immer, dass jemand meine Romane liest und am Ende weint.“
Und weinen kann man zum Beispiel, wenn sich Muszer an den Alltag im „Regermanisierungslager“ Friedland erinnert, für das er auch prompt einen passenderen Namen ersinnt: „,Schattige Eiche’ wäre nicht schlecht. Und obendrein echt germanisch.“
Oberhessische Presse vom 26.September 2000
© Clemens Niedenthal
Dariusz Muszer: Die Freiheit riecht nach Vanille, Roman. A1 Verlag, München, 216 Seiten


