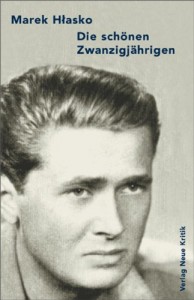 Eine Rezension? Auf keinen Fall. Lieber ein Aasgeier sein, der über einer erhobenen Hauptes sterbenden polnischen Legende kreist. Warum überhaupt sollte ich wagen, eine Rezension über „Die schönen Zwanzigjährigen“ zu schreiben? Warum sollte ich für Marek Hlasko einen Werbespot drehen? Er lebt ja nicht mehr, ihm hilft es nicht, wenn irgendjemand ein paar Worte über „eine Art Memoiren“, wie er sein Buch bezeichnete, reimt oder auch nicht. Er wird nicht das Geringste davon haben, keinen Penny, dass man seine Bücher jetzt auf deutsch, albanisch oder Suaheli veröffentlicht und verkauft. Er braucht es nicht mehr, seinen Kontoauszug mit zitternden Händen vor seine Nase zu halten. Er lebt nicht mehr, einer der größten und umstrittensten polnischen Dichter der sozialistischen Epoche, „ein Idol der polnischen lost generation der fünfziger Jahre“, wie ihn Marta Kijowska in ihrem Nachwort nennt, ist tot, und zwar schon sehr lange. Jedenfalls für unsere Verhältnisse, wo es für einen Autor höchstens fünf Minuten zu verschenken gibt. Es war ein zufällig geplanter Tod: zu wenig Schlaf, zu viel Stress, zu viele Tabletten, zu viel Alkohol. Das klingt nicht so spektakulär und patriotisch wie Selbstmord. Ja, für viele Polen ist es enttäuschend: Hlasko hat sich nicht zu Tode gesoffen aus Sehnsucht nach seiner geliebten Heimat, wie es sich für einen richtigen polnischen Schriftsteller gehört, sondern er ist wie ein gewöhnlicher amerikanischer Star von uns gegangen. Am 14. Juni 1969 in Wiesbaden. Herzstillstand. Er war fünfunddreißig Jahre alt. Bücher hat er geschrieben, die einmal Menschen bewegten. Jetzt schert sich der Teufel um seinen Nachlass – und manchmal auch ein Verleger.
Eine Rezension? Auf keinen Fall. Lieber ein Aasgeier sein, der über einer erhobenen Hauptes sterbenden polnischen Legende kreist. Warum überhaupt sollte ich wagen, eine Rezension über „Die schönen Zwanzigjährigen“ zu schreiben? Warum sollte ich für Marek Hlasko einen Werbespot drehen? Er lebt ja nicht mehr, ihm hilft es nicht, wenn irgendjemand ein paar Worte über „eine Art Memoiren“, wie er sein Buch bezeichnete, reimt oder auch nicht. Er wird nicht das Geringste davon haben, keinen Penny, dass man seine Bücher jetzt auf deutsch, albanisch oder Suaheli veröffentlicht und verkauft. Er braucht es nicht mehr, seinen Kontoauszug mit zitternden Händen vor seine Nase zu halten. Er lebt nicht mehr, einer der größten und umstrittensten polnischen Dichter der sozialistischen Epoche, „ein Idol der polnischen lost generation der fünfziger Jahre“, wie ihn Marta Kijowska in ihrem Nachwort nennt, ist tot, und zwar schon sehr lange. Jedenfalls für unsere Verhältnisse, wo es für einen Autor höchstens fünf Minuten zu verschenken gibt. Es war ein zufällig geplanter Tod: zu wenig Schlaf, zu viel Stress, zu viele Tabletten, zu viel Alkohol. Das klingt nicht so spektakulär und patriotisch wie Selbstmord. Ja, für viele Polen ist es enttäuschend: Hlasko hat sich nicht zu Tode gesoffen aus Sehnsucht nach seiner geliebten Heimat, wie es sich für einen richtigen polnischen Schriftsteller gehört, sondern er ist wie ein gewöhnlicher amerikanischer Star von uns gegangen. Am 14. Juni 1969 in Wiesbaden. Herzstillstand. Er war fünfunddreißig Jahre alt. Bücher hat er geschrieben, die einmal Menschen bewegten. Jetzt schert sich der Teufel um seinen Nachlass – und manchmal auch ein Verleger.
Als ich zum ersten Mal „Die schönen Zwanzigjährigen“ gelesen habe, war Jahr 1979 und ich war zwanzig. Für eine halbe Nacht habe ich eine Xerokopie der „Instytut Literacki“-Ausgabe von einem Bekannten geliehen bekommen, um Mitternacht musste ich es weiterreichen, sonst würde ich keine Untergrundbücher mehr erhalten; die anderen Buchwürmer standen schon ungeduldig Schlange. „Die schönen Zwanzigjährigen“ sind 1966 im polnischsprachigen „Instytut Literacki“ in Frankreich erschienen und waren offiziell jahrzehntelang in der Volksrepublik Polen verboten, eigentlich bis zum bitteren Ende des gefälschten Sozialismus. Die Strafe war hart und nicht gerecht. Totschweigen. Keine Bücher veröffentlichen. Marek Hlasko wurde schon in den späten unwilden Fünfzigern mit einem kommunistischen Anathema belegt. Mehr konnte man von den commies nicht verlangen, sie haben das Nötige getan, um die Sache ins Rollen zu bringen: Eine Legende konnte entstehen, ein osteuropäisches Märchen über einen von der bösen Regierung verstoßenen Dichter. Ja, es gab einmal schöne Zeiten, als sich die kommunistischen Könige für Literatur interessierten. Jetzt ist alles Schnuppe. Irgendwie schade. Im Vergleich mit aktuellen europäischen Regierungen waren die commies wahrhaftig intellektuell veranlagt, echte Intelligenzbolzen. Literatur war für sie wichtig, einen Mord wert oder zumindest eine Verbannung, eine Ausbürgerung. Wie bei den alten Griechen. Hlaskos Literatur würde heute keine Chance mehr haben durchzukommen, für die Herrschenden hat die Literatur keine Bedeutung mehr. Nichts hat für sie eine Bedeutung, gar nichts. Und darauf sollten wir einen trinken.
Gegenwärtig lese ich „Die schönen Zwanzigjährigen“ auf deutsch und staune: Wie konnte es sein, dass ein solch miserables Buch mich damals so tief bewegte? Liegt das an mir oder an der germanischen Sprache, die angeblich nicht imstande ist, slawische Untertöne korrekt wiederzugeben? Kein Problem, es reicht, die Hand auszustrecken, im Bücherregal steht das polnische Original, 4. Ausgabe aus dem Jahr 1989, zwar teilweise durch die Zensorenschere verstümmelt, aber für mein Experiment durchaus brauchbar. Ein paar Stunden lesen und vergleichen. Ein wenig Mühe lohnt allemal. Der Text von Roswitha Matwin-Buschmann ist vorzüglich, an Kongenialität grenzend, und das muss man volltönend loben. Bei den Übersetzungen aus dem Polnischen – einer Sprache, die die deutschen Verleger traditionsgemäß stiefmütterlich behandeln – ist das nicht selbstverständlich; in dem Bereich gibt es ja so wenige begnadete Nachdichter und so viel Vetternwirtschaft.
Worüber aber schreibt dieser Mann, dieser fremdsprachige Marek Hlasko? Was will er eigentlich sagen außer, dass er geklaut, gearbeitet, geschrieben und getrunken hat? Seine politischen Gedanken scheinen mir so frisch zu sein wie ein Stück Kaugummi, das Nikita Sergejewitsch Chruschtschow während des XX. Parteitages kaute. Wer zum Kuckuck war Chruschtschow? Ein Politiker, der einmal mit seinem Schuh auf das Pult klopfte und später von seinen Kumpels als Unperson behandelt wurde. Was Chruschtschow für die sowjetische Politik gemacht hat, hat Hlasko für die polnische Literatur gemacht. Beide haben eine Tür geöffnet und beide haben sich dabei die Finger eingeklemmt.
Dann lese ich weiter. Es wird immer besser. Man muss nur Hlaskos politische Ansichten überfliegen, man muss weiterblättern, wenn er das Beste über Hassliebe zwischen Amerika und Polen von sich gibt oder wenn er seine persönlichen Feinde bloßstellt – und schon haben wir ein ganz akzeptables Märchen. Ein Hans reist um die Welt und versucht mit aller Kraft, ins Konzentrationslager (so bezeichnet Hlasko Polen in „Der Nächste ins Paradies“) zurückzukommen. Und er entschuldigt sich bei seinen Warschauer Freunden, dass es ihm nicht ganz gelingt. Die bösen Hexenmeister, die commies, sind schuld daran, weil sie seinen Pass keinesfalls verlängern wollen.
Im Grunde genommen hat Marek Hlasko nie die Volksrepublik Polen verlassen, er hat nur in verschiedenen Ländern gelebt. Das wusste er genau. Er ist bis an sein Ende ein Sohn der commies geblieben. Die Chance, ein großer Dichter zu werden, hatte er. Die Geschichte aber hat ihm übel mitgespielt: Nach dem blutlosen Abgang des europäischen Kommunismus bleibt „Die schönen Zwanzigjährigen“ eine journalistische Märchensammlung aus einem Konzentrationslager, an die niemand glaubt und die nur manche lesen. Darüber sollte man nicht traurig sein. Zum Glück hat er ja auch andere Bücher geschrieben.
Marek Hlasko, Die schönen Zwanzigjährigen. Aus dem Polnischen von Roswitha Matwin-Buschmann. Mit einem Nachwort von Marta Kijowska. Verlag Neue Kritik 2000, 261 S.
LISTEN, Heft 59, Frankfurt, Oktober 2000


